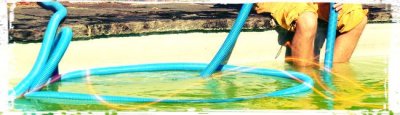Der folgende Textbeitrag über Calafou in dem Buch Völlig utopisch hat mich sehr an eigene Ideen, Visionen und Provisorien u.a. beim Projekt Lebensdorf erinnert. Da der Text von Julia Macher veröffentlicht wurde unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz, nutze ich diese Gelegenheit, ihn hier entsprechend zu veröffentlichen. Alle Fotos vor und nach dem Beitrag sind eigene Aufnahmen, entstanden rund um das Projektzentrum Lebensdorf.
Jenseits von Silicon Valley: Die Hacker von Calafou
von Julia Macher
Der Weg nach Calafou ist mühselig. Das liegt nicht an den anderthalb Stunden im rumpelnden Regionalzug, nicht am anschließenden Fußmarsch hangabwärts quer durch den Wald, nicht an der sengenden Sonne. Der Weg nach Calafou ist so mühselig, weil vor der realen Begegnung mit der Hacker-Gemeinschaft erst diverse virtuelle Hürden überwunden werden müssen.
Im Frühjahr 2011 zogen zwei Dutzend junge Menschen aus Barcelona, Sevilla, Bilbao und anderen spanischen Großstädten ins katalanische Hinterland. In einer still gelegten Textilfabrik wollten sie freie Software und elektronisch gesteuerte Agrarmaschinen entwickeln, sich technologisches Know How jeder Art aneignen: für ein Leben in Eigenregie, jenseits eines Systems, das – so die Hacker von Calafou – von Großunternehmen und korrupten Politikern kontrolliert wird.
Besucher, so steht es auf der Homepage, sind prinzipiell willkommen. Doch zuvor möchten die Hacker einiges wissen. Warum und mit welcher Absicht ich schreibe? Wen ich zu welchem Thema wann sprechen möchte? Und: unter welcher Lizenz ich den Text zu veröffentlichen gedenke? Willkommen bin ich nur, wenn ich das Ergebnis unter einer Creative Commons oder Free Culture Lizenz veröffentliche – das machen sie von Anfang an klar. Als Beitrag zum Weltwissen, und habe dieser auch nur die Träume einiger spanischer Netzenthusiasten zum Thema, soll auch meine Reportage jedem zugänglich sein. Sie soll unbegrenzt kopiert, vervielfältigt, geteilt und weiterbearbeitet werden dürfen. Es geht nicht nur um einen symbolischen Beitrag zu ihrer Utopie, quasi um eine ideelle „Revolutionssteuer“, sondern um politische Kohärenz. Also arbeite ich mich in die Kürzelsprache des Creative Commons Recht ein, spreche mit dem Verlag über die Lizenzvergabe – noch bevor eine Zeile geschrieben ist. Eine absurde Situation, aber das "Wie" ist für die Hacker von Calafou mindestens ebenso wichtig wie das "Was". Diese Erfahrung werde ich noch einige Male machen.
Als der Regionalzug in Vallbona d’Anoia, einem kleinen verschlafenen Dorf hinter dem wuchtigen Gebirgsmassiv Montserrat, hält, steigt neben mir noch ein etwas korpulenter Mann Anfang 30 mit kurzen schwarzen Haaren aus. Wir schultern unsere Rucksäcke, stapfen schweigend nebeneinander her einen staubigen Forstweg talabwärts. Sein Rammstein-T-Shirt ist schon durchgeschwitzt, als wir ins Gespräch kommen. Rob lebt seit ein paar Wochen in Calafou, „auf Probe“, sagt er. Das Leben in Barcelona ist ihm zu teuer geworden, im Krisenspanien als ungelernter Arbeiter einen Job zu finden so gut wie unmöglich. In Calafou hat er in den letzten Wochen Heizöfen und Solarkocher gebastelt. Als hinter der letzten Wegbiegung die Steineichen den Blick freigeben auf die hell getünchte Fassade der Fabrikanlage im Tal, bleibt Rob stehen und sagt: „Was ich in Calafou gelernt habe, bringt mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiter.“ Es klingt ein wenig auswendig gelernt. Heute entscheidet die Asamblea, die wöchentliche Vollversammlung, ob er noch ein paar Wochen bleiben darf.
Eine schmale Zementbrücke führt über einen Fluss, zu einem langgestreckten flachgiebeligen Bau, mit steinumfassten Bogenfenstern. Wer durch das Tor die still gelegte Anlage betritt, staunt zunächst über die Dimensionen: Das Areal erstreckt sich über 28.000 Quadratmeter. Allein die Hauptfabrikhalle hinter der Toreinfahrt ist so groß wie ein Fußballfeld. Die zwei dreigeschossigen Gebäude davor bergen Werkhalle und Gemeinschaftsräume; ein Haus haben die Bewohner von den Grundfesten neu gebaut, der Mörtel zwischen den unverputzten Backsteinen scheint gerade erst getrocknet.
Ein Feldweg führt, vorbei an einem wild wuchernden Kräutergarten und einer Deponie mit Bauschutt zu einer kleinen Anhöhe, auf der sich ein Riegel mit dreistöckigen Wohnbauten erstreckt. Die Fensterhöhlen sind zum Teil noch leer, an einem Treppenaufgang steht ein Betonmischer.
Calafou ist eine ehemalige Industriekolonie aus dem 19. Jahrhundert, in der die Arbeiter nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen sollten – um sie so von der Großstadt Barcelona und dem dort grassierenden revolutionären Gedankengut fernzuhalten.
Rund hundert solcher Kolonien gab es in Katalonien im 19. Jahrhundert, die meisten von ihnen innerhalb der Textilbranche. Das System funktionierte bis ins 20. Jahrhundert hinein. In Calafou verließen die letzten Arbeiter ihre Wohnungen in den 60er Jahren, die Fabrik stellte ihren Betrieb 2004 ein. Nachdem ein Brand das gesamte Dach der Haupthalle zerstört hatte, verkaufte der Besitzer das Areal für ein paar Hunderttausend Euro an eine Genossenschaft unter dem Dach der Cooperativa Integral Catalana, einem Netzwerk aus Sozialinitiativen, Wohn- und Landwirtschaftsprojekten. Instandgesetzt haben die Bewohner bisher nur das Allernotwendigste, das Gelände mit Feldwegen erschlossen, Treppen und ein Plumpsklo gebaut, ein paar Fenster und Türen eingesetzt.
Von irgendwoher klingelt es: das Signal für die wöchentliche Asamblea. Zwei Frauen schleppen einen Stapel weißer Plastikstühle auf eine Wiese, unter eine mächtige alte Kastanie vor der Toreinfahrt. Der Stuhlkreis füllt sich langsam: ein paar Männer mit sanftem Blick und Ziegenbärtchen, resolut wirkende Frauen in erd- und ölverschmierten Arbeitsoveralls. Ein Vater mit seinem zehnjährigen Sohn, eine Mutter mit erwachsener Tochter, auf einer Gartenbank studieren zwei englisch sprechende Rucksackreisende eine Karte. Ein Laptop surrt, Finger fliegen über die Tastatur, die Sitzung beginnt. Protokollieren ist in Calafou keine lästige Formalität, sondern Kerngeschäft. Das entspricht dem Geist des Projekts: Kopiere, teile und trage dazu bei, das geteilte Wissen zu mehren – das funktioniert nur, wenn alle jederzeit Zugriff auf alle Informationen haben. Protokolle, Beschlüsse, Bedarfslisten, Satzung, Arbeitsgruppen - alles Wichtige steht in der projekteigenen Wikipedia. Die Lektüre ist Pflicht.
Die Satzung von Calafou teilt die Bewohner in drei Gruppen ein, mit unterschiedlichem Stimmrecht: die „Siedler“, ein fester Kern von knapp 30 Männern und Frauen, der von Anfang an fest in das Projekt eingebunden ist und sich so das Wohnrecht in den 27 ehemaligen Arbeiterwohnungen erworben hat. Dann sind da die Kurzzeitbesucher, die wegen eines Seminars oder aus Neugier ins Tal hinabgeklettert sind oder sich auf Durchreise befinden und für ein paar Tage rasten. Und schließlich die Langzeitbesucher, die mit einer Projektidee nach Calafou kommen oder sich bestehenden Arbeitsgruppen anschließen, in der Hoffnung, bleiben zu dürfen. Die Versammlung zieht sich in die Länge. Jeder soll zu Wort kommen, jeder Einwurf gilt als wichtig. Spricht jemand zu laut, zu aggressiv, gibt es Einspruch. Anderswo verdreht man über ein dahin gesagtes „Da könnte ich ausrasten“ die Augen, in Calafou ist es Grund für eine Abmahnung. Sprache transportiert nicht nur Informationen, sondern auch Machtstrukturen und Hierarchien möchte hier niemand.
Als Rob an der Reihe ist, fasst er sich kurz: Er würde gerne weiter in der Arbeitsgruppe Heiz-und Brennöfen arbeiten. Den aus einer Tonne und einem Metallregal zusammengeschraubten und mit Glasmehl isolierten transportablen Brotofen haben ein paar Bewohner bereits in Augenschein genommen; die Bewohner heben die Arme und drehen mit den Händen in der Luft. Keine Gegenstimmen, Rob kann vorerst bleiben.
Die Teilzeitbewohner leben für zwei Euro pro Tag oder zehn Euro die Woche im „roten Haus“, dem Gebäude mit den frisch gemauerten Backsteinwänden: In den Sälen liegen Matratzen auf Europaletten, statt Glas verschließt Kunststofffolie viele Fensterhöhlen. Stromanschluss gibt es nur dank Verlängerungskabeln im Flur, drahtlosen Netzanschluss überall. „Am Anfang war das Internet, dann kam der Strom, danach haben wir uns über die Wasserversorgung Gedanken gemacht“, fasst eine junge blonde Frau mit Pferdeschwanz die Genese des Hackerparadieses zusammen. Bis die selbstgebaut Solar- und Hydraulikanlage funktioniert, kommt der Strom noch vom örtlichen Elektrizitätswerk. Für den Zugang zum Datennetz hat das freie Funknetz Guifi.net gesorgt, über eine Antenne am Rande des Areals.
Spideralex gehört zu den Mitbegründerinnen des Projekts. Wie die meisten der „Siedler“ hat sie bereits vorher in netzaffinen Politikkollektiven gearbeitet, nebenbei Soziologie studiert und in Wirtschaft promoviert. Letzteres erzählt sie nur auf Nachfrage. Akademische Titel zählen nichts in Calafou, hier sind fast alle Autodidakten, schon per Definition. „Ein Hacker“, sagt Spideralex, „ist jemand, der sich nicht mit vorgefertigten Lösungen zufrieden gibt, jemand, der hinterfragt und sich Dinge selbst aneignet.“ In Sevilla hat Spideralex gemeinsam mit Freunden den Prototypen für das soziale Netzwerk N-1 entwickelt, eine nicht-kommerzielle, selbstverwaltete Online-Plattform, bei der der Schwerpunkt im Gegensatz zu Netzwerken wie Facebook auf der Gruppe statt auf der Selbstdarstellung liegt. Den Durchbruch erlebte das Projekt im Frühsommer 2011, als in spanischen Großstädten Jugendliche die öffentlichen Plätze besetzten. Auf den Asambleas an der Puerta del Sol und der Plaza Catalunya wurde nicht nur über Wirtschafts- und Systemkrise diskutiert, sondern auch über Datensicherheit und „technologische Souveränität“. Wer Sprüche wie „Wir sind keine Ware in den Händen der Wirtschaft“ auf Transparente schrieb, konnte seinen Protest schlecht über Facebook organisieren, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. In wenigen Wochen schnellten die User-Zahlen von N-1 von 3000 auf 50.000 hoch. Das nennt man wohl eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen wird N-1 über die Plattform Lorea von Calafou aus verwaltet, vom „Hacklab“, dem Informatiklaboratorium der Kolonie.
Lautes Hupen unterbricht das Gespräch, auf dem Hof klappern Autotüren: Ein paar Bewohner haben auf dem Wochenmarkt zwei Kisten Birnen und drei Wassermelonen ergattert, Essen, das sonst auf dem Müll gelandet werden. Spideralex schleppt gemeinsam mit den anderen die Kisten zur Gemeinschaftsküche. „Guck dir doch später das Hacklab an“, sagt sie, bevor sie hinter der Tür verschwindet. Mitkommen möchte sie nicht.
Es ist später Abend geworden, als ich mich auf den Weg mache. Ich finde das Hacklab in einem Nebenflügel der Fabrik, über einer leeren Lagerhalle, in der noch ein Dutzend leerer Chemikalienfässer steht. Fledermäuse schwirren durch die offenen Fenster. Etwas Licht dringt aus der offenen Tür.
Als ich hineingehe, nimmt zunächst niemand Notiz. Zwischen mit Computergehäusen, Monitoren und ausgebauten Festplatten vollgestopften Regalen sitzen ein paar Männer vor ihren Laptops. Sem, Anfang 20, schwarzer Wuschelkopf, Pantoffeln und trotz der Sommernachtshitze im langärmligen T-Shirt, guckt auf das Balkendiagramm auf seinem Bildschirm: Es zeigt die Entwicklung des Phone Liberation Networks, eines von ihm mitentwickelten freien privaten Telefonnetzes, das nicht hierarchisch aufgebaut ist, mit einer Zentrale, die Nummern vergibt, sondern theoretisch um beliebig viele selbstverwaltete Knotenpunkte erweitert werden kann. Eine Art Keimzelle für die Telefonrevolution von morgen, sozusagen.
Die Technik, Internet-Telefonie, funktioniert ähnlich wie bei Skype. Untereinander telefonieren die Nutzer kostenlos, in die Fest- und Mobilfunknetze geht es konkurrenzlos günstig. Sem klickt auf eine buntgescheckte Weltkarte. Das Phone Liberation Network hat in aller Welt Pakete bei verschiedenen Voice over IP-Providern, also Anbietern von Internet-Telefonie, gekauft und ins eigene Netz übernommen. Was zum Gratisangebot gehört – etwa Festnetzanrufe innerhalb eines Landes -, wird geteilt; die kostenpflichtigen Anrufe werden für einen kleinen Mehrpreis weiterverkauft. So können die Nutzer konkurrenzlos günstig telefonieren. Ein Blick auf die Karte verrät die Tarife: China und die USA sind türkis gefärbt, dorthin sind alle Telefonate kostenlos, Europa, Russland, Teile von Lateinamerika leuchten in unterschiedlichen Blautönen – dorthin sind alle Festnetzgespräche gratis, Handytelefonate kosten zwischen einem und neun Cent.
Seine Mutter habe früher monatlich 80 Euro ausgegeben, jetzt telefoniere sie für 30 Euro, sagt Sem.
Wie auf Bestellung klingelt das Telefon, Sem wimmelt freundlich ab: „Ja, Mamá, ich melde mich später.“ Für den Mittzwanziger war schon während des Informatik-Studiums in Barcelona klar, dass er freie Software entwickeln wollte. Als Freunde nach Calafou zogen, wurde aus dem Arbeits- ein Lebensprojekt. „Vielleicht wäre es bequemer, in einer gemütlichen Wohnung in Barcelona Programme zu schreiben, aber das wäre nicht stimmig: Auf so ein Gemeinschaftsprojekt muss man sich ganz einlassen, das ist Teil des Abenteuers.“ Vermutlich wäre es anders auch nicht möglich: Das Leben in der selbstverwalteten Kommune spart Geld. Nur ein Drittel der Bewohner hat einen Job außerhalb von Calafou. Wer dauerhaft an Projekten des Hacklab mitarbeitet, bekommt Wohnraum zur Verfügung gestellt. Programmierer wie Sem lassen sich von der Cooperativa Integral Catalana in der Internetwährung Bitcoins zahlen, die auch die Gemeinschaftsküche akzeptiert. Der Barcode dafür hängt an der Pinnwand, neben der Aufgabenliste für das Küchenteam. Die Industriekolonie von einst hat sich an digitale Zeiten angepasst und ihr eigenes Wirtschaftssystem entwickelt.
Sems Finger flitzen über die Tastatur. Das Programm, das die Nutzerkonten und die Bilanzen verwaltet, hat er entwickelt. Die Gewinnmargen des Phone Liberation Networks sind für alle einsehbar. „Als Betreiber verdienen wir fast nichts; drei, vier Euro waren es in den letzten Wochen.“
Einer der Progammierer, lange schwarze Haare, portugiesischer Akzent, mischt sich ein. „Das kannst du so nicht sagen! Das wirtschaftliche Potenzial ist doch gigantisch. Wir haben bisher 60 Nutzer, aber rechne die Summe auf alle potenziellen Nutzer hoch!“ Seinen Namen will er nicht nennen, aus Prinzip. Wer im Netz etwas recherchiere, finde ohnehin alle Daten; das wirklich Interessante, seine Arbeit, sei frei. Er holt Luft, setzt an zu einem Exkurs über die Machenschaften der internationalen Telefonmafia. In Wahrheit, sagt er, gehörten alle Provider zu einer Firma, einem Finanzdienstleister, dessen Monopol es zu brechen gelte. „Diese Piraten blockieren den Markt, verhindern Entwicklung und Innovation!“ Die Namen Snowden und NSA schwirren durch den Raum, über die massive Internetkontrolle durch die US-amerikanische National Security Agency hat sich hier niemand gewundert. Dass "das System" auch in Spanien böse und korrupt ist, daran zweifelt keiner. Es kursieren Geschichten über Direktoren der zur Neutralität verpflichteten, staatlichen Telekommunikations-Regulierungsbehörde, die sich mit Visitenkarte des größten privaten Anbieters, der Telefónica, vorstellen. Und über den systematischen Boykott von freien Software-Projekten durch staatliche Stellen. „Wenn das Eigeninteresse über dem der Allgemeinheit steht, dann ist Hacken doch unsere moralische Verpflichtung“, sagt der Mann mit den schwarzen Haaren. Sem nickt. Dabei gehe es nicht darum, fremde Systeme oder bestehende Netze zu zerstören, sondern freie, offene Alternativen zu schaffen. Für Menschen, die wie er keine Kompromisse mehr eingehen wollen und so autark wie möglich sein möchten. Wer keine Massentierhaltung will, kauft keine Käfigeier; wer nicht will, dass Telefonkonzerne mit Daten Schindluder betreiben und sich dafür fürstlich entlohnen lassen, telefoniert über das PLN. „Es geht um technologische Souveränität“, sagt Sem und führt mich im Raum herum. Am Nebentisch arbeiten zwei Programmierer an der Oberfläche von eGora, einem Online-Shop, über den Produkte von ökologischen Kooperativen ge- und verkauft werden können. Eine andere Gruppe tüftelt über einer Technik, mit der sich Telefongespräche zwischen den Bewohnern der Kolonie und regulären Teilnehmern verschlüsseln lassen. Warum? „So macht das eben das Militär!“ Lachen. „Nein, es geht einfach um den Schutz unserer Privatsphäre“. Tatsächlich wähnen sich die Hacker unter ständiger Beobachtung. Zur Gewissheit über den bevorstehenden Systemkollaps kommt ein diffuses Gefühl der Bedrohung – durch den Staat, die Polizei, verfeindete Hackerkollektive.
Die Konterfeis der Heroen, auf die sich die Hacker von Calafou berufen, hat jemand in Überlebensgröße an die Wand des Raums gepinselt: Ganz links Captain Crunch, der sich in den 70ern in das Telefonnetz einhackte und kostenlos um die Welt telefonierte, in dem er mit einer Trillerpfeife in den Hörer blies. Das gesprochene Wort und die Signalisierungsdaten liefen damals auf der gleichen Leitung. Da die Trillerpfeife den gleichen Ton erzeugte wie die 2600 Hertz-Frequenz, die die Telefonzentrale als Signal für „Leitung frei“ gespeichert hatte, konnte Captain Crunch nach einem Pfiff einfach eine neue Nummer wählen und zum Ortstarif weiter sprechen. Daneben, etwas kleiner, die Portraits von Code-Knacker Alan Turing, der wegen seiner Homosexualität in der Psychiatrie zwangskastriert wurde und sich schließlich umbrachte; Ada Lovelace, Programmiererin des ersten mechanischen Computers und der US-amerikanischen Computer-Pionierin Grace Hopper. Diese beiden Bilder, sie sind die einzigen Frauen im Raum.
Am nächsten Morgen tagt eine Gruppe zum Thema Ernährungssouveränität in Calafou. Spideralex erklärt ihnen, wo sie Wasser, Stühle, Projektor finden. Eine Frau hat Schwierigkeiten, sich ins Internet einzuloggen, Spideralex holt den Systemadministrator aus der Küche. Als wir wenig später über den Feldweg zu den Arbeiterwohnungen stapfen, schimpft sie: „Es ist doch immer wieder das Gleiche: Keiner dokumentiert vernünftig das Netzwerk, so dass am Ende immer nur ein paar Wenige Bescheid wissen!“
Spideralex öffnet die Tür zu ihrer Wohnung. Die Wände sind frisch gestrichen, in der Ecke steht noch der Farbeimer; die Matratze auf dem Boden steckt in einer Plastikfolie. Spideralex ist viel unterwegs, hält in Stockholm, Tunis, Amsterdam Vorträge zum Thema „Technologische Souveränität“ – und zum Thema Gender. Das Hacklab hat sie schon seit ein paar Wochen nicht mehr betreten. „Irgendwann“, sagt Spideralex, „habe ich ein paar der Programmierer dort einfach nicht mehr ertragen“. Während auf dem Gasherd der Mokka kocht, doziert Spideralex über die „Überheblichkeit des Nerds“, über Hacker, die ihr Herrschaftswissen nicht teilen, weil sie sich für klüger, intelligenter, subversiver halten: Wer als Administrator den Server oder als Programmierer die Software kontrolliert, untergräbt die flachen Hierarchien. Wenn er nicht will, dass ein Tool im System implementiert wird, dann wird es nicht implementiert. Solches Verhalten trete bei Männern signifikant häufiger auf als bei Frauen, erklärt die Soziologin und setzt nach: "Häufiger als bei Frauen und feminismusgeschulten Männern."
„Vielleicht haben wir einfach einen anderen Zugang“, sagen Julito und Klau. Den beiden Frauen ist so gar nicht nach soziologischer Genderanalyse, die beiden hasten durch das Hardlab, ihre 12 Quadratmeter große „Werkstatt für bioelektrochemische Instrumente“. Klau, Schweißerbrille, den schwarzen BH am Mittelsteg zu einer Art Weste aufgeschnitten, räumt Kabel und Adapter von einem Regal ins andere. Auf einem Tisch stapeln sich kaputte Elektrogeräte, Rohmaterial für Experimente. Julito, halb Glatze, halb schulterlange Mähne, fischt zwei Dosen Tonic Water aus dem Kühlschrank. Aus dem Computer knarzt, dröhnt, hämmert es, alles gleichzeitig. „Wir lieben Noise“, sagt Julito und schenkt einen Gin Tonic ein. Klau, Schweißerbrille, nickt. Pechblende haben die beiden ihr Laboratorium genannt, Pechblende wie das uranhaltige Gestein, mit dem Marie Curie in ihrem Heimlabor experimentierte. Ursprünglich arbeiteten sie nebenan, bei den Programmierern im Hacklab; aber der Staub, der sich auf den Computertischen sammelte, vertrug sich nicht mit den elektronischen Bauteilen – und der Umgangston der Computernerds nicht mit ihrem. „Ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, Mittdreißigern den Unterschied zwischen Feminismus und machismo zu erklären – und auf anzügliche Blicke kann ich sowieso verzichten“, sagt Klau. Also zogen sie gemeinsam mit einer Freundin aus und starteten nebenan ihr eigenes Projekt.
In Seminaren haben die Frauen aus dem Pechblendlabor den Calafoubewohnern gezeigt, wie sich aus ein paar Brettern, Glas und Metallresten ein Sonnendörrer für Lebensmittel basteln lässt. Sie haben eine automatische Bewässerungsanlage entwickelt, mit zwei Nägeln als rudimentärem Sensor: Low Tech für den Alltag in der „postindustriellen Kolonie“. „Aber eigentlich“, sagt Julito und verdreht die Augen, „kann ich die Unterscheidung in nützlich und nicht-nützlich nicht leiden.“ Es gehe doch erst einmal darum, die Kiste aufzumachen und zu gucken, was drin ist – das mache einen echten Hacker aus.
Am nächsten Tag in der Gemeinschaftsküche. Die Programmierer aus dem Hacklab kommen geschlossen an. Sem kippt sich Müsli und Milch auf den Teller. Die Stimmung ist angespannt. Es geht um die Lizenzierung des Textes. Den Hackern ist die ganze Creative Commons Geschichte nicht ganz geheuer, sie plädieren für GNU-Lizenzen, wie sie für freie Software vergeben werden. Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung des Werkes sind dabei grundsätzlich gestattet, auch unter kommerziellen Zwecken. Das Creative Commons mit seinen vielen Abstufungen habe doch mit „freier Kultur“ nichts mehr zu tun. Dass inzwischen viele Verlage unter ihre Bücher und Texte ein CC BY-NC-ND setzen – Weitergabe ohne Bearbeitung bei Namensnennung gestattet, so lange damit kein Geschäft gemacht wird – halten sie für ein Unding. „Wenn ein NC für Non Commercial unter deinem Namen steht“, sagt einer, „darf keine Webseite, die irgendwo ein Banner hat, kein kleines Stadtteilmagazin deinen Text mehr veröffentlichen.“ „Er darf nicht einmal mehr in die Wikipedia“, tönt es von der anderen Ecke des Tisches. „Bis jetzt haben die Creative Commons doch nur Anwaltskosten generiert, alles Wissen muss grundsätzlich frei sein, ohne irgendeine Einschränkung“.
Die Debatte wogt hin und her, bis einer resolut unterbricht: „In zehn Jahren werden die Nahrungsmittel knapp, dann beginnen die grossen Umverteilungskämpfe. Für solchen Kinderkram haben wir nun wirklich keine Zeit mehr.“
Draußen hupt ein Pickup. Die Wasserleitung hat ein Leck, in der gesamten Kolonie gibt es kein Trinkwasser. Spideralex sammelt Plastikkanister ein, um am Dorfbrunnen Wasser zu zapfen. Der Weg zur technologischen Souveränität ist auch hier, in Calafou, mühselig.